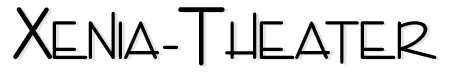Pariser Tagebuch 1942 – 1944 von Hélène Berr

Juden Stern in Frankreich
Quelle: wikipedia
Lesung mit Nathalie Cellier und Myriam Siegrist, Cello
Dauer: ca. 1 Stunde
„Es gibt in diesem Tagebuch zwei Teile, das merke ich, wenn ich den Anfang wieder lese: es gibt den Teil, den ich aus Pflichtgefühl schreibe, um das in Erinnerung zu behalten, was später erzählt werden muss, und es gibt den Teil, der für Jean geschrieben ist, für mich und für ihn.
Es erfüllt mich mit Glück zu denken, dass, wenn ich verhaftet werde, Andrée diese Seiten aufbewahrt, etwas von mir, das, was mir am kostbarsten ist, denn sonst hänge ich jetzt an nichts Materiellem mehr; retten muss man seine Seele und sein Gedächtnis.“
Hélène Berr, Mittwoch den 27. Oktober 1943
Zur Lesung
Aus chronologischer Perspektive betrachtet ist das Pariser Tagebuch der Hélène Berr ebenso in zwei Teilen gegliedert. Der erste Teil, vom 7. April bis zum 28. November 1942, erzählt aus ihrem Leben als Englischstudentin an der Sorbonne, über ihre Familie, ihre Freundschaften und Liebschaften, vor allem aber, aus dem Leben einer jungen Frau, die zusehen muss, wie die Schlinge der anti-jüdischen Gesetze sich um sie und ihre Angehörigen zusammenzieht, die mitten in der Zeit der Verfolgungen dafür kämpft, alles was ihr an „normalem Leben“, an Freude übrig bleibt, zu bewahren. Hélène hat sich die Aufgabe auferlegt, über alle Fakten, die ihr bekannt sind, zu berichten, über die Ereignisse, die ihre Verwandten, ihren Bekannten- und Freundeskreis sowie die gesamte jüdische Bevölkerung und die Oppositionellen betreffen: Verfolgungen, Deportation, Mord. Sie will für die Nachwelt ein Zeugnis hinterlassen, damit die Verbrechen nie in Vergessenheit geraten, damit die nächsten Generationen erfahren können, welche Barbarei unter dem Naziregime geherrscht hat. Hélène setzt sich mit der grausamen Aktualität auseinander, die ihren Alltag begleitet. Alles, was man nicht zu glauben vermag, wird zur Realität, der Realität eines Alptraumes, die jede andere Realität verschlingen wird.
Im ersten Teil des Tagebuches gibt es zahlreiche Passagen, die über unerträgliche Geschehnisse berichten. Es ist schwer, diese Passagen laut zu lesen, vielleicht, weil man ein Gefühl des Unbehagens nicht unterdrücken kann, das dem der Schande für die Menschheit ähnelt, und weil man bei diesem Gefühl von einer tiefen Traurigkeit überwältigt wird, und um so schwerer, sie für Zuhörer und Zuschauer zu lesen: Das Fazit ist zu erschreckend, es würde heißen, sich selbst und seinem Publikum Gewalt anzutun. Im Gegenteil könnte man meinen, dass, wenn man die Gräuel, mit denen Hélène uns konfrontiert, öffentlich lesen, sie sozusagen in einer Gemeinschaft „teilen“ würde, damit der Versuch gemacht würde, mit Hélènes Stimme den Opfern der Shoah in dieser Gemeinschaft zu gedenken und zu ehren. Darin sehen wir aber folgende Gefahren, die die Situation einer öffentlichen Lesung unvermeidlich mit sich bringt, einerseits, die, dass wir ein Stück weit zu „Voyeurs“ werden und andererseits die, dass wir uns den Mut „aneignen“, den Hélène Berr, in ihrer extremen Einsamkeit aufgebracht hat, indem sie vollbracht hat, was sie für ihre Pflicht hielt: ihrer Hand die Berichterstattung von dem zu diktieren, was sich viele aus ihrer Nähe weigerten zu glauben. Vielleicht ist es besser, diesen Weg des Grauens, den Hélène sich stets bemüht, uns vor Augen zu führen, allein zu gehen, in der stillen Andacht, die das Bewusstwerden, so unvollständig es auch sein mag, für das Grad an Unmenschlichkeit, die während Hitlers Regimes geherrscht hat, uns auferlegt.
Wir haben es vorgezogen, das Wesentliche unserer Lesung auf den zweiten Teil und damit auf einen anderen Aspekt des Tagebuches zu konzentrieren. Jean Morawiecki, der Verlobte von Hélène, den sie erst sechs Monate früher kennen gelernt hatte, verläßt sie am 26. November 1942, um die Freie Zone und von dort aus nach Spanien und dann nach Nordafrika zu gehen. Nach seiner Abreise wird Hélène fast ein ganzes Jahr schweigen. Am 10. Oktober 1943 setzt sie ihr Tagebuch fort. Wenn Hélène weiter mit Genauigkeit über den Genozid berichtet – und sie hat in jedem Augenblick ihres Lebens alle Gründe anzunehmen, dass sie selbst ihm zum Opfer fallen wird – so erhebt sich doch aus diesem zweiten Teil eine neue Stimme, die Stimme ihres „neuen Ichs“: ein "Ich" der absoluten Aufrichtigkeit, sich selbst und ihren Angehörigen, aber auch allen anderen gegenüber. Ein Ich, das die Einheit sucht zwischen ihrem Glauben an die Literatur („Die Dichtung ist die höchste der Sachen“) und ihrem „offenem Bewußtsein“ für das Unfassbare, dem Millionen zum Opfer werden. Ihre Leidenschaft für Literatur und Bildung kollidiert mit ihrer Hellsichtigkeit. Die gewünschte Verbindung und Einheit zwischen ihrem intellektuellen Horizont und ihrem moralischen Engagement – greifbar durch ihre Tätigkeit bei der Vereinigung L’Entraide temporaire, die 500 jüdische Kinder retten wird und bei der UGIF, auch wenn diese Organisation zu Recht bei ihren Zeitgenossen sehr umstritten war – diese Wesenseinheit wird unmöglich, denn zur jeder Stunde „ regnet der Tod auf die Welt“. Könnte es der Barbarei gelingen, die Literatur überflüssig zu machen? Wie hätte Hélène Berr, als Jüdin im Winter 1944 während der deutschen Besatzung, sich diese Frage nicht stellen müssen? Dieser innere Zwiespalt ist für sie eine Quelle des Leidens, durch welchen sie ihr „Gleichgewicht verlieren„ könnte, der sie an die Schwelle des Wahnsinns bringt, sie, die am 11. Januar 1944 schreibt: „die Essenz meines Wesens, ist die Einheit des Geistes“.
Diese Stimme, die Hélène Berr Jean Morawiecki widmet, ist die Stimme einer Schriftstellerin, die versucht, die Zeit der Barbarei zu transzendieren und auf einen Weg hinweist, der die Welt menschlicher machen könnte - eine Stimme der Liebe und des Friedens.